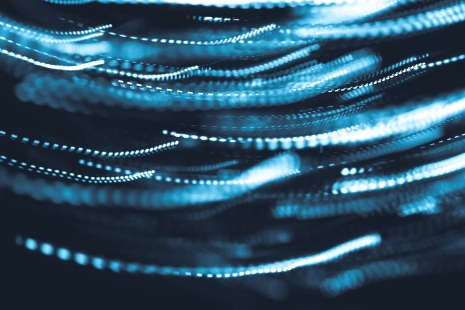„Das Verhältnis zum Anderen geht der Selbstaffektion der Gewissheit voraus, auf die man die Kommunikation immer zurückzuführen sucht. Die Kommunikation wäre aber gerade unmöglich, wenn sie im Ich beginnen müsste, dem freien Subjekt, dem jeder Andere nur Begrenzung wäre, die zum Krieg einlädt, zur Beherrschung, zur Vorsicht und zur Information.“
(Emmanuel Levinas)
1881, an seinem 21. Geburtstag, bekam der Kanadier Ernest Seton von seinem Vater eine Rechnung präsentiert, die sämtliche Kosten des Vaters für den Sohn aufführten: von der Versorgung und Erziehung bis hin zum Honorar für den Arzt, der bei der Entbindung geholfen hatte. Er zahlte seinem Vater die berechneten 537,50 Dollar zurück und sprach danach nie wieder ein Wort mit ihm (Atwood 2008, 9). Sie waren fertig miteinander. So absurd die Anekdote ist, so bezeichnend ist sie zugleich für die ökonomische Logik, die unserem gegenwärtigen Modell von Identität zugrunde liegt. 2010 stellen die Performer*innen des Kollektivs She She Pop in ihrem Stück „Testament“ dieses patriarchale Modell auf den Kopf und problematisieren seine zugrundeliegende Logik. Drei ihrer Väter stehen mit auf der Bühne und es werden u.a. Kalkulationen darüber angestellt, inwiefern kinderlose Töchter oder Söhne ein höheres Erbe antreten sollten als Geschwister mit Kindern. So fordert etwa die Performerin Mieke Matzke finanziellen Ausgleich „für all die großelterliche Liebe, die jetzt schon Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag, an mir vorbei direkt in diese beiden Kinder meines Bruders fließt, und da für immer versickert.“ Ergebnis des berechneten Ausgleichs sind 156.325.- € (dynamischer Wert, Stand 2015). „Und, Papa, wir können dann auch gern über Ratenzahlung sprechen.“ „Jaja, ganz bestimmt“ (She She Pop, UA 2010).
Beide Beispiele thematisieren (das zweite in ironischer Brechung) das Verhältnis von Identität und Schuld(en), frei nach Emmanuel Levinas, als „eine minutiöse Buchführung“ (Levinas 1992, 279).[1] Dies wiederum setzt die Annahme voraus, dass sich Identität quantifizieren ließe und dass mein Wert, meine Wertschätzung sich bemessen ließe, je nachdem, welchen Status ich besitze oder welche Leistung ich erbracht habe. Vermeintliche Leistungsträger deklamieren manchmal allen Ernstes: „Er ist ein sehr wertvoller Mensch.“ Das implizite Eingeständnis, es gäbe demnach wertlose Menschen, spricht Bände.
Das Wer und das Was
Ein Teil des Problems steckt in einer weiteren impliziten Grundannahme, nämlich der, dass jede/r primär nach egologischer Selbstbestätigung strebt. Der Andere ist dabei nur ein „Umweg [...], den das Subjekt gehen muss, um zu sich selbst zu gelangen,“ um narzisstische Selbstbestätigung zu erfahren (Bedorf 2010, 69). Wir sprechen also von einem anerkennungstheoretisch fundierten egologischen Modell, das kaum den Blick vom eigenen realen und symbolischen Kontostand abzuwenden vermag. Dieses Modell ist strukturell gewaltförmig, weil es zu einer Ökonomisierung und Verdinglichung von Identitäten führt.
Dass diese Perspektive nicht alternativlos ist, lässt sich gut an der Unterscheidung zwischen Wer und Was zeigen, die Hannah Arendt einführt. Das Was bezeichnet die Eigenschaften, Rollen, Talente, etc., die jemand haben mag, die ihr oder ihm aber v.a. zugeschrieben werden, z.B. Sohn, Frau, Homosexueller, Schwarze, Flüchtling, etc., aber auch Koryphäe, Spitzensportler, CEO, Professor. Es verdinglicht die andere Person partiell, in dem sie einer Was-Gruppe zugeordnet wird, und es verfestigt dieses Was in einem fertigen Bild. Doch das „unverwechselbar einmalige des Wer-einer-ist, das sich so handgreiflich im Sprechen und Handeln manifestiert, entzieht sich jedem Versuch, es eindeutig in Worte zu fassen. Sobald wir versuchen zu sagen, wer jemand ist, beginnen wir Eigenschaften zu beschreiben, die dieser Jemand mit anderen teilt, und die ihm gerade nicht in seiner Einmaligkeit zugehören. Es stellt sich heraus, dass die Sprache, wenn wir sie als ein Mittel der Beschreibung des Wer benutzen wollen, sich versagt und an dem Was hängen bleibt“ (Arendt 1958, 169ff.).
Was für die an Washeiten orientierte Anerkennung von Anderen gilt, gilt natürlich auch für das Selbstverhältnis: Wenn jemand sich erst durch die Anerkennung seiner Leistungen, seiner Merkmale und Eigenschaften, seines Status, etc. als wertvoll begreift, heißt das, dass er sich ohne diese für wertlos hält – und das läuft auf eine gefährliche identitäre Was-Reduktion im Sinne Arendts hinaus. Doch mit genau dieser Reduktion haben wir es gegenwärtig in besonderem Maße zu tun – auch wenn die daran geknüpfte ökonomische Logik von der Erbsündenlehre bis zu Finanzkrisen nichts wirklich Neues ist.
Neu ist, dass – wie Isolde Charim zeigt – die Fragwürdigkeit der Fiktion einer „vollen Identität“ – in der gewissermaßen das Wer und das Was verschmelzen – durch die globale Pluralisierung für alle spürbar wird. Wir leben im „identitären Prekariat“ (Charim 2018, 24, 48). Dadurch, dass die Gewissheit der eigenen Identität nicht mehr selbstverständlich gegeben ist (auch wenn diese Gewissheit immer schon phantasmatisch und auf Kosten anderer war), wird sie als defizitär erfahren. Das vermeintliche „Minus-Subjekt“ oder „Weniger-Ich“ (ebd., 46) entwickelt in diversen Varianten – dem Ressentiment verwandt – eine Art Schuldwut: Der Nationalist oder Fundamentalist unterschiedlicher Couleur trachtet danach, sein Weniger dadurch zu kompensieren, dass er sich mit einem Wir identifiziert, das ein Mehr verspricht: Die vermeintlich volle, deswegen wertvollere Religion oder Kultur, das vermeintlich volle, deswegen wertvollere Geschlecht. Das jeweilige Minus oder Mehr ist jedoch eines des Was. Denn das Wer lässt sich nicht quantifizieren. Das heißt, das Problem des empfundenen Entzugs des Weniger-Ichs lässt sich auf ein von vorneherein falsches Bewertungsraster zurückführen. Für die Legitimation ihrer Überlegenheit werden Maximalinstanzen (Natur, Gott) aufgerufen, die ebenfalls zu einem Was instrumentalisiert werden.
Ich bezeichne dieses Phänomen als Schuldwut, weil jeweils die Annahme zugrunde liegt, dass mir etwas entzogen wurde, das zurückzuholen ich berechtigt wäre. Und zwar, weil das, was mir entzogen wurde, mir rechtmäßig zusteht, mir gehört. Es wird nicht lediglich ein Entzug beklagt und wieder eingeklagt, sondern der Verlust wird überdies personalisiert. Andere haben es mir weggenommen, und also darf ich es mir von ihnen zurückholen – genau genommen darf ich diese anderen sogar bestrafen, da das, was sie mir geraubt haben, ja rechtmäßigerweise in meinem Besitz war – insbesondere, weil das, was sie sie mir weggenommen haben, durch die Zumutung eines Schuldgefühls für die eigene Identität ersetzt wird (darf man denn als Mann/als Deutscher/als Weißer gar nichts mehr (sagen)?).
Und was haben sie mir geraubt? Gewissheit.
Wir kranken nämlich an einem Willen zur Gewissheit, und der Triumph des Gewissheitswillens ist dabei sogar noch desaströser und pathologischer als sein depressives Scheitern daran, das lediglich die Schattenseite dieser Logik darstellt. Gewissheitstriumpheure richten ihre Aggressionen nach außen, Depressive nach innen, gegen sich selbst.
Schon 1929 bemerkte John Dewey, dass „die Suche nach einer universalen Gewissheit, die für alles gelten soll“, nichts anderes als eine „kompensatorische Perversion“ darstellt (Dewey 1998, 228). Aus der fast schon unschuldig anmutenden Ambition einer Gewissheitssuche ist heute ein stählerner Gewissheitswille geworden, der davon ausgeht, dass er Gewissheit verdient, als würde sie ihm rechtmäßig zustehen. Als würde, wenn diese ausbleibt, ihm jemand etwas vorenthalten oder wegnehmen, das er sich deswegen zurückzuholen habe, zur Not mit Gewalt. Das Streben nach Gewissheit hat eine lange philosophische Tradition, in der Moderne seit Descartes, der behauptet hatte, Zweifel ließen sich willentlich herbeiführen, mit dem Ziel, Gewissheiten zu erlangen (und sogar einen Gottesbeweis führen zu können).
Ich möchte aber auf einen spezifischen Aspekt der Gewissheit hinaus, den ich als Distinktionsgewissheit bezeichne. Denn der Schuldwütige zielt nicht auf epistemologische Evidenz, sondern auf eine Gewissheit, die ihn von anderen abhebt. In die Gewissheit ist gewissermaßen bereits die Rache an den anderen eingearbeitet, die ihn seiner Gewissheit beraubt haben (die Frage, ob das nicht schon bei Descartes so war, lasse ich hier beiseite). Die anderen werden für die eigene Selbstbestätigung benutzt, indem sie auf Washeiten reduziert werden.
Ich muss an dieser Stelle ein bisschen ausholen, um dann zu zeigen, wie sehr wir imaginative Zweifel brauchen, um diese gefährliche Logik zu durchbrechen.
Schuld und Identitätsbildung
Die unheilige Allianz aus Schuld und Identität rührt an den empfindlichsten Kern unseres westlichen Konzepts von Autonomie: nämlich an die Bildung des Selbst. Diesem Konzept von Autonomie kann mit Friedrich Nietzsche und Sigmund Freud attestiert werden, dass zu seiner Genese die Internalisierung von Aggressionen in Form von Schuld sowie die Verdrängung unliebsamer Anteile unerlässlich ist, die – um sie vom Selbstbild fernzuhalten – ausgelagert und abgewertet werden müssen. Nietzsche behauptet bekanntlich, dass Moralität, von der wir seit Immanuel Kant annahmen, dass sie auf einer ahistorischen Vernunft und dem freien Willen basiert, tatsächlich das Resultat einer historischen Umstülpung darstellt, in der die zuvor nach außen gerichtete Aggression sich nach innen, gegen sich selbst richtet. Zuvor fröhlich und amoralisch an anderen ausgelebte Grausamkeit tobt sich nun am Selbst in Form von Schuldgefühlen aus. Ja, durch diesen Prozess entsteht überhaupt erst das, was wir Selbst oder Subjekt nennen und damit Moralität.
Freud exerziert diesen Gedanken anhand der psychosexuellen Entwicklung jedes Individuums und seiner Ich-Bildung durch: Ich-Sagen zu lernen bedeutet, durch die ödipale narzisstische Kränkung hindurchgegangen zu sein und damit anzuerkennen, dass man nicht der Mittelpunkt des Universums ist, sondern von anderen abhängig, deren Freiheit man – um es mit Sartre auszudrücken – gezwungen ist anzuerkennen. Kein Ich, kein Selbst ohne die Anderen, die vor mir da waren.
Das Problem sitzt tief. So bekennt Richard Rorty an einer Stelle: „In unserer Gesellschaft fällt es weißen, heterosexuellen Männern – und zwar sogar ernsthaft egalitär gesinnten weißen, heterosexuellen Männern – meiner Generation nicht leicht, die mit Schuldgefühlen vermischte Erleichterung darüber abzuwehren, dass sie nicht als Frauen, Homosexuelle oder Schwarze zur Welt gekommen sind” (Rorty 2000, 324). Rorty artikuliert ein interessantes Mischgefühl: Einerseits das mit Schuldgefühlen vermischte Lustgefühl der Erleichterung über die eigene privilegierte Identität, andererseits das Bedürfnis, dieses Mischgefühl abzuwehren, weil das Schuldgefühl daran erinnert, dass dieses Privileg ungerecht ist. Auch die Abwehr ist ambivalent, denn sie kann auch die Abwehr gegenüber der empfundenen Erleichterung meinen. Doch wie lässt sich die Schuldökonomie überwinden, ohne in destruktive Abwehrmechanismen zu rutschen?
Ich-Bildung oder Identitätsbildung bedeutet, Teil der normativen oder symbolischen Ordnung zu werden, indem man sich Grenzen auferlegt. Aggressionen werden kontrolliert, indem das Selbst sie – in Form internalisierter Instanzen – gegen sich selbst richtet. „Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war, und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt.“ (Adorno/Horkheimer 1990, 40).
Schuldgefühle sind gegen sich selbst gerichtete Grausamkeit. Furchtbar ist an dieser Zurichtung, von der Adorno und Horkheimer schreiben, dass sie sich, früher oder später, wieder nach außen kehrt. Grausamkeit ist kein gelegentlich auftretender unangenehmer Nebeneffekt einer eigentlich harmlosen Autonomiebildung, sondern der Preis, den andere für sie zahlen. Von Schuldwut zu sprechen unterstreicht diese gegen das Selbst gerichtete Aggression des Schuldgefühls, die sich früher oder später Bahn bricht und wieder nach Außen richtet, indem sie anderen die Schuld gibt. Das lokale Schuldgefühl nach einem konkreten Konflikt kann aufgelöst werden – strukturelle Schuld, von der Nietzsche, Freud und Rorty sprechen, hingegen nicht.
Dabei ist der Schuldbegriff, aus meiner Sicht, grundsätzlich gewaltförmig, weil er Wut steigert und nicht verringert, weswegen er durch einen Begriff radikaler Verantwortung abgelöst werden sollte. Die ökonomische Logik des Abrechnens denkt in Kategorien von Belohnung und Bestrafung. Wer etwas richtig getan hat, soll belohnt, wer etwas falsch getan hat, bestraft werden. Und Schuldwütige glauben, die Bewertungsinstanz zu verkörpern. Belohnung und Bestrafung sind dabei lediglich zwei Seiten der gleichen Medaille. Und sie gehören der gleichen Währung an, nämlich, in den Worten Marshall Rosenbergs, der Sprache der Gewalt.
Die mit Schuldgefühlen vermischte Erleichterung, von der Rorty spricht, nicht als Frau, Homosexueller oder Schwarzer zur Welt gekommen zu sein, legt selbstkritisch Zeugnis ab von einer partiellen – wenn auch selbstreflexiven – Auslagerung. Schuldwut zeichnet sich aber dadurch aus, dass sie von Selbstzweifeln frei ist und sich daher unkritisch bei anderen Erleichterung zu verschaffen sucht. Witze auf Kosten genannter Bevölkerungsgruppen wären ein Beispiel dafür. „Die Angst, die einem selbst nicht mehr droht, explodiert im herzhaften Lachen, dem Ausdruck der Verhärtung des Individuums in sich selbst, das richtig erst im Kollektiv sich auslebt“ (Adorno/Horkheimer 1990, 120).
Innerhalb des Nietzsche-Freud-Rorty-Modells versucht jedes Selbst aufgrund seiner Genese, wenn es nach Autonomie strebt, sich Erleichterung von seiner strukturellen Schuld, und ich würde hinzufügen: Wut, zu verschaffen. Schuldwut beschreibt den Übergang von Internalisierung zur Entäußerung dieser Aggression. Diese strukturelle Schuldwut begründet sich durch die der Autonomie immer anhaftenden Heteronomie, etwas von anderen bekommen zu haben, das nicht mir gehört: Sprache, Prägung etc. Dadurch bleibe ich an andere gebunden und in dieser Bindung permeabel. Es gibt jedoch verschiedene Formen der Schuldwut und Strategien, sich ihrer zu entledigen.
Grausamkeit und Distinktionsgewissheit
Rortys Analysen sind deswegen so interessant, weil er sich selbstkritisch das avancierteste Modell von Autonomie innerhalb westlichen Denkens vornimmt, nämlich das des „starken Dichters“ (der ein Philosoph, ein Schriftsteller sein kann), der sich selbst erschafft; dem es also gelingt, seine eigene Welt zu produzieren, um am Ende, mit Nietzsche, sagen zu können: „So wollte ich es.“ Diese ästhetische Freiheitskonzeption, die bis heute im Wertekanon westlicher Gesellschaften hoch im Kurs steht und von der angenommen wird, dass sie über die von Ressentiment getriebenen Wutbürger weit erhaben ist, erweist sich jedoch zugleich als avanciertestes Modell für Grausamkeit.
Rorty beschreibt u.a. am Beispiel Heideggers dieses Modell. Starke Dichter wie Heidegger empfinden Schuld, weil sie „den Gedanken nicht ertragen können, dass sie sich nicht selbst geschaffen haben“ (Rorty 1989, 183). Sie streben nach einer besonderen Form von Autonomie, nämlich Selbsterschaffung durch Erzeugung eines, wie er es nennt, neuen Vokabulars, das sich von der Vergangenheit befreit und die Zukunft prägt. Innerhalb dieser Logik bedeutet Selbsterschaffung, mit der „Vergangenheit abzurechnen.” Das Selbst strebt danach, die Macht der Prägungen abzustreifen, danach, „der Vergangenheit dasselbe antun zu können, was sie ihm anzutun versucht hat: Er [der starke Dichter, H.S.] hofft zu erreichen, dass sie seine Prägung trägt“ (Rorty 1989, 62).
Rückt man Selbsterschaffung in diesen Kontext von Schuld und Vergeltung, wird deutlich, wie die aus ihr resultierende ästhetische Autonomielust mit Grausamkeit zusammenhängt: Der Triumph der Steigerung eigener Autonomie mittels eines eigenen Vokabulars ist dann gekoppelt an die grausame Genugtuung einer Demütigung der eigenen Vergangenheit, der schmerzhaft vor Augen geführt werden soll, dass sie nicht länger Macht über das Selbst hat (ähnlich wie Seton seinem Vater vor Augen führte, dass er ihm nicht länger etwas schuldig war). Typisch für den starken Dichter ist, dass er seine eigene Sensibilität (von der man alltagssprachlich annehmen würde, dass sie sich v.a. auf andere Menschen richtet) auf die Entwicklung seines eigenen Vokabulars konzentriert und dabei dazu neigt, andere als ästhetisches Material zu benutzen. Grausamkeit zielt dann nicht nur auf die personalisierte Vergangenheit, sondern nimmt auch die Vergleichgültigung gegenüber depersonalisierten Anderen in der Gegenwart in Kauf. Die Vergangenheit wird quasi personalisiert und Autonomiebildung heißt hier, sich an ihr für das zu rächen, was sie dem Selbst angetan hat, nämlich noch partiell fremdbestimmt zu sein (Salaverría 2007, 167-190).
Abrechnen hat eine Doppelbedeutung: Es bedeutet einerseits, den (imaginären oder tatsächlich kalkulierten) asymmetrischen Kontostand auszugleichen, also dafür zu sorgen, dass man quitt ist. Andererseits, dass man sich rächt: Mit jemandem abzurechnen bedeutet, jemandem das, was er einem angetan hat, heimzuzahlen. Nie meint man damit, jemanden, der einen beglückt hat, nun ebenfalls zu beglücken. Etwa, dass der Vater von Seton dem Sohn die Stunden des Glücks vorrechnete, die der Sohn dem Vater geschenkt hat und die er ihm nun monetär zu erstatten beabsichtigte. Im Stück „Testament“ wird zwar das Glück der Zuwendung – in ästhetischer Brechung – ökonomisiert, aber es ist das Glück der anderen (in diesem Fall der Kinder des Bruders, in denen die großelterliche Liebe „für immer versickert“), wofür Ausgleich gefordert wird, da es an der Protagonistin selbst lediglich „vorbeifließt.“
Die der Schuldökonomie zugrundeliegende Haltung ist, anders gesagt, latent misstrauisch oder paranoid – was man anderen schuldig ist oder was andere mir schulden, ist grundsätzlich etwas Ungutes, potenziell bedrohlich. Dafür gibt es mindestens zwei Gründe, zum einen die unfreiwillige Bindung an andere, zum anderen die damit verknüpfte Permeabilität.
Pierre Bourdieu hatte am distinguierten Geschmack der Oberschichten kritisiert, dass ihre verfeinerten ästhetischen Urteile die Klassendifferenzen, auf denen sie basieren, verschleiern. Ähnlich wie einst das Gottesgnadentum Monarchien legitimierte, legitimiert bei ihnen ein vermeintlich transzendentales Vermögen – in Form einer bei der Oberschicht besonders entwickelten Autonomie – ihre ökonomischen Privilegien. „Es verleiht mit der Gewissheit, im Besitz der kulturellen Legitimität zu sein, Selbstsicherheit und jene Ungezwungenheit, an der man die herausragende Persönlichkeit zu erkennen glaubt“ (Bourdieu 1994, 121). Distinktion erscheint frei, autonom, basiert jedoch auf Ausschlussprozessen, die durch sie weiter verstärkt werden. Gewissheit ist demnach, in diesem Kontext verstanden, keine erkenntnistheoretische Angelegenheit, sondern eine Frage der Distinktionsabsicherung, welche die eigene Selbsterschaffung stabilisiert.
Diese Distinktionsgewissheit ist grausam, weil sie dem Anderen seine unterlegene Heteronomie vorführt, während sie dafür – paradoxerweise – dessen angreifbare Autonomie braucht: Ein Gegenüber mit Selbstbewusstsein dafür, gerade gedemütigt zu werden – das klassisch Hegelsche Anerkennungsproblem, allerdings im ästhetischen Gewand. Sie ist auch paradox, weil sie für ihre Vergewisserung Publikum benötigt, das die vermeintliche Unabhängigkeit und Unangreifbarkeit des Distinguierten bezeugen kann. Er ist also abhängig von der Bezeugung seiner Unabhängigkeit. Er ist gebunden an die Bezeugung seiner Ungebundenheit, permeabel in Hinblick auf die Bezeugung seiner Impermeabilität. Distinktionsgewissheit ist deswegen grausam, weil sie das Paradox nur dadurch – scheinbar – auflösen kann, dass es andere dazu zwingt, diesen Zustand zu bezeugen. Anders gesagt, sie lebt von der Demütigung anderer.
Grausamkeit kann Menschen nur durch Menschen zugefügt werden, weil uns durch sie wieder ein Teil von dem entzogen wird, was wir in der Selbstwerdung von ihnen bekommen hatten. Selbsterschaffung zielt auf Demütigung durch Distinktionsvergewisserung, indem sie anderen die trügerische Gewissheit ihrer Autonomie entzieht.
Dieser schmerzhafte Entzug wird erzeugt, wenn das Selbst genötigt wird, anzuerkennen, dass es vom anderen zum Objekt degradiert werden kann und dass der Andere weiß, dass das Selbst weiß, dass es zum Objekt degradiert worden ist, obwohl es kein Objekt ist. Demütigung ist unfreiwillig und passiv, doch gleichzeitig reflexiv. Wenn mich beispielsweise jemand durch ein Geschenk beschämt, gehe ich davon aus, dass es ein Versehen war. Sollte sich jedoch herausstellen, dass der Schenker mich absichtlich beschämt hat, dann empfinde ich Demütigung. Zum Charakter der Demütigung gehört das Bewusstsein des Gedemütigten für die erfolgreiche Intention des Anderen, den Gedemütigten für die eigene Lust zu instrumentalisieren.
Der höchste Genuss besteht aus dieser sadistischen Perspektive darin, den Anderen zu brechen, sich dessen nun verlorene Integrität einzuverleiben und dadurch einen Autonomierausch, einen Gewissheitstriumph zu erleben, und zwar gerade deswegen, weil der Sadist sie ihm zugefügt hat, gewissermaßen Autor der Demütigung ist. Dies ist die größte Angst Rortys: Dass die eigene Selbsterschaffung die Demütigung oder sogar Folter des Anderen zur Kunstform erhebt, wie er u.a. am Beispiel der Romanfigur O’Brien aus Orwells 1984 diskutiert.
Auslagerung und Vampirismus
Die Schriftstellerin Zadie Smith fragt sich in einem Interview, warum eine politische Bewegung wie „Black Lives Matter“ bei manchen Weißen derartige Wut erzeugt. Schon als Kind im Londoner Schulbus hatte sie sich gewundert, warum manche Weiße so empört reagierten, wenn beispielsweise eine Gruppe von Bengalen sich auf Bengalisch unterhielten. „What is it about white people that find the idea of any collectivity that excludes them so upsetting?“ Smith deutet selbst eine Antwort an, sie fragt die Interviewerin: Waren Sie schon verheiratet – oder in einer Beziehung? „Insecurity, jealousy, and a kind of vanity that you always need to be included…“ (Smith 2018). Eifersucht empfindet man, wenn einem Zuwendung entzogen zu werden droht, die sich dann auf andere richtet. Und genau das trifft die Schuldwut derjenigen, die sich über „Black Lives Matter“ aufregen, über Menschen, die es sich erlauben, eine andere Sprache zu sprechen, über Frauen, die es sich erlauben, gegen Übergriffe aufzubegehren.
Frustrierte AfD-Wähler (die, wie wir wissen, beileibe nicht alle „bildungsfern“ sind), White Supremacists, Männer, die sich über „Feminazis“ echauffieren, etc. streben dabei danach, ihr „Weniger-Ich“ durch Errichtung einer Wir-Festung, der sie zugehören, zu kompensieren, und sich dadurch von denen abzuheben, die nicht dazugehören.
Der Knecht bearbeitet bei Hegel die Dinge für den Herrn, die dieser dann genießt. Der Herr genießt jedoch nicht nur die bearbeiteten Dinge, sondern auch die darin gespeicherte Unterwerfung des Knechts, die er sich auf diese Weise einverleibt. Die Oberschicht genießt bei Bourdieu ihren feinen Geschmack, der sie von der Unterschicht abhebt. Sie genießt aber nicht nur die Kunst, sondern auch die darin gespeicherte Demütigung derjenigen, die zu dieser Form von Autonomie vermeintlich nicht fähig sind. Die Lust speist sich also aus der Exklusivität, aus dem Ausschluss und der damit verknüpften Vergewisserung der eigenen Autonomie.
Der Nährwert von Grausamkeit sind die erzwungenen Zweifel des Opfers, durch die die Fantasie absoluter Gewissheit über die eigene Selbstbestimmtheit vorübergehend ausgelebt werden kann. Der Täter lagert seine eigenen Ängste und Schuldgefühle aus. Menschen, die gedemütigt worden sind, vergessen das nicht.
Klageweiber übernehmen die Arbeit des Trauerns, damit man es (jedenfalls in der Öffentlichkeit) nicht selbst tun muss. Opfer von Gewalt machen die Zwangsarbeit ewiger Bindung an den Täter, ewiger Permeabilität ihm gegenüber. Sie fühlen, was er nicht (mehr) fühlen kann. Eine pervertierte Form erzwungener Empathie. Der Grausame genießt, dass das Opfer an ihn gebunden und permeabel bleibt, ernährt sich davon vampiristisch. Und dadurch, dass er das Opfer gezwungen hat, bleibt bei ihm die Fantasie der Ungebundenheit und Impermeabilität bestehen, die im Phantasma der Distinktionsgewissheit gipfelt.
Dass Klageweiber Frauen sind, ist kein Zufall. Sie lassen sich aber darüber hinaus auch stellvertretend als Figur für das verstehen, worum es hier geht: Frauen, Schwarze, Homosexuelle, all jene Bevölkerungsgruppen, die in Gesellschaften als heteronom, als die/der Andere gelten, werden nicht nur auf einer materiell-ökonomischen Ebene ausgeschlossen und benachteiligt. Auf einer tieferliegenden Ebene übernehmen sie die Arbeit der Bindung und Permeabilität für diejenigen in privilegierten Positionen, die dies an sie auslagern.
Wenn „die Anderen“ jedoch diesen unausgesprochenen und gewaltförmigen Vertrag aufkündigen – durch Frauenbewegungen, Bürgerrechtsbewegungen, durch „Black Lives Matter“ oder #MeToo, dann erzeugt das deswegen Schuldwut bei Privilegierten, weil ihnen gewissermaßen der Hahn zugedreht wird. Die sich ungebunden und impermeabel wähnende Autonomie entwickelt Entzugserscheinungen. Wenn plötzlich Schwarze Präsidenten und Kinder von Gastarbeitern Minister werden, wenn nicht länger die tägliche Zufuhr ungebrochener Bewunderung der Sekretärin für den Chef strömt, dann erzeugt das Wut. Das Weniger-Ich muss nun selbst mit seiner Gebundenheit und Permeabilität zurechtkommen.
Um dieses Modell von Autonomie zu durchbrechen, muss deswegen ein anderes Konzept von Subjektivität stark gemacht werden. Es kann nicht Distinktionsgewissheit für alle geben, wenn man daran festhält, führt das zu Krieg. Das Gegenmodell muss deswegen die Attraktivität einer Subjektivität des Zweifelns verdeutlichen, bei der der Abschied von der Gewissheit nicht als Minus oder Weniger erlebt wird, sondern als Mehr.
Imaginative Zweifel. Komplementär zur Distinktionsgewissheit möchte ich einen nicht erkenntnistheoretischen, sondern ästhetisch-politischen Begriff des imaginativen Zweifels stark machen. Dieser tritt auf mehreren Ebenen in Kraft: Produktionsästhetisch, insofern als kreative Prozesse sich an den Rändern des Verständlichen und damit scheinbar Unzweifelhaften bewegen. Diese Ränder sind jedoch nicht trennscharf abgezirkelt. In Anlehnung an William James könnte man vielmehr von „Fransen“ des Selbst- und Weltverständnisses sprechen. Wenn man vom Zweifel die Angst vor Demütigungen abzieht, über die Rorty so viel schreibt, ist es nicht so, dass nichts übrigbleibt. Im Gegenteil: In Anknüpfung an Marilyn Fryes „Flirts mit der Sinnlosigkeit“ (Frye 1983, 154) kann man von einem Eros imaginativer Zweifel sprechen, die die Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen bilden. Sie bauen diese Brücke aber nicht dadurch, dass sie die mitschwingende Demütigung einfach ausblenden, sondern im Gegenteil durch ein thematisierendes und problematisierendes Aufblenden von Demütigungen, Ausschlüssen, Ungerechtigkeiten, etc. Diese werden überhaupt erst greifbar, indem sie von einer neuen Perspektive aus durchdacht und durchfühlt werden, die, um es mit Viktor Frankl zu sagen, sich nicht alles von sich selbst gefallen lässt. Schuld und Demütigung lassen die Autorität von anderen (äußeren oder internalisierten) unbezweifelt als Instanz gelten. Der Zweifel ist dagegen antiautoritär, weil er diese Instanzen selbst noch einmal problematisiert und durch diese Problematisierung einen ersten Schritt aus ihrem Bann heraustritt. Der imaginative Zweifel verwandelt Erfahrungen der Demütigung in eine Sprache oder andere Zeichen, die diese Verwandlung selbst für andere ästhetisch, und das heißt zwanglos, erfahrbar machen. Man kann also von einer transformativen Kraft imaginativer Zweifel in zweierlei Hinsicht sprechen: Produktionsästhetisch geben sie dem zuvor diffus Demütigenden eine nichtdemütigende Gestalt. Rezeptionsästhetisch stoßen sie zwanglos (Selbst-)Zweifel am bislang für selbstverständlich Gehaltenen und latent Grausamen an.[2]
Ein Kritikpunkt, der an der rezeptiven Seite imaginativer Zweifeln geäußert werden könnte, ist, dass sie völlig kontraintuitiv sind: Wie kann denn die Verunsicherung der eigenen Position lustvoll sein? Zeigt die gegenwärtige politische Lage nicht gerade, dass es bereits zu viel Verunsicherung gibt, dass es nicht an Zweifeln mangelt, sondern an Sicherheiten, nach denen die Menschen sich sehnen? Dieses Argument bleibt der gefährlichen Liaison von Lust und Selbst-Gewissheit verhaftet, deren identitärer Gewissheitswille auf einem deformierten Bild von Subjektivität fußt: Einem Selbst, das seine Lebendigkeit eingebüßt hat, weil es immer schon fertig sein will, weil es Lebendigkeit mit Genugtuung verwechselt; das letztlich auf Macht gründet, weil es von dem Willen getrieben ist, sich so oft und so weit wie möglich abzusichern, und zwar gegenüber anderen, denn es fürchtet nichts so sehr wie Demütigung (schlimm, wenn die Welt dem Selbst Gewissheit entzieht; schlimmer, wenn es die Anderen sind). Weswegen es stets versucht, anderen durch dosierte Demütigung (beispielsweise durch ästhetischen Distinktionsgewinn) ihre Lebendigkeit abzuzapfen. Dass die Genugtuung über einen errungenen Anerkennungszuwachs gegenüber jemand anderem Lust erzeugen kann, ist nicht zu bestreiten. So funktioniert auch Sadismus. Aber es ist eine Lust, die die ökonomische Logik von Leistungsmaximierung, Wachstum, Konkurrenz und Ausschluss reproduziert. Diese Lust für die einzige Lust oder sogar für die einzig richtige Lust zu halten, heißt, eine entfremdete und zwanghafte Form von Lust zu totalisieren. Dabei wird vergessen: Lust ohne Zweifel ist eine Sparversion von Lust, die sich am Bekannten, an Garantien festzuhalten versucht und deswegen gleichzeitig egologisch und fremdbestimmt ist. Was man für Gegensätze hält, fällt zusammen. Das Egologische zeichnet sich durch seine Fremdbestimmheit aus. Denn der egologische Vorteil oder Nutzen ist bloß die verinnerlichte Umsetzung des fremdbestimmten ökonomischen Prinzips der Nutzenmaximierung. Der Gedanke, es könnte subjektive Lust geben, die weder fremdbestimmt noch egologisch ist, ist innerhalb dieser Gewissheitslogik kaum nachvollziehbar, stellt aber den einzigen Weg dar, um diese Logik zu überschreiten.
Im Unterschied zum identitären Denken in Was-Bildern, welches immer schon glaubt, fertig zu sein, ist Zweifeln eine Form unfertigen Denkens und Urteilens des Wer.
Zweifel bewegen sich an den Rändern bestehender Strukturen und Was-Bilder, an den Rändern des jeweiligen Common Sense und seines Rationalitätsverständnisses und damit auch an den Rändern des Selbst. Deswegen lassen sich im Zweifel vermeintlich rationale und irrationale Impulse nicht sauber trennen. Was jeweils als rational und als irrational gilt, lässt sich nur vor dem jeweiligen historischen Hintergrund verstehen, austragen und verschieben. Und das Austragen der Auseinandersetzungen um diese Verschiebungen ist letztlich immer eine politische Frage. Was gestern als irrationaler Impuls galt (Frauenwahlrecht, abstrakte Malerei, Impfung, Jazz, Smartphones), gilt heute als rationaler Common Sense.
Wenn man hingegen glaubt, dass Gedanken und Gefühle etwas bereits Fertiges sind, das man vor anderen schützen muss, dann ist gerade das paradoxerweise Ausdruck von Entfremdung. Denn das, was man für das Eigenste hält, ist ein fremdes Readymade. Die aufgerufenen gebrauchsfertigen Gefühle sind in Wirklichkeit gar nichts Eigenes, sondern vorgegebene Gefühlsmuster, identifizierbare Washeiten, in denen an einer historisch präfigurierten Sinnordnung von Liebe, Freude und Schmerz festgehalten wird. Eigentlich versteht man sich selbst dann gar nicht, weil die vorgegebenen Gefühls-Readymades dem eigenen Empfinden äußerlich bleiben. Sie werden auf etwas Diffuses, das erst noch verstanden werden will, aufgeheftet und verdecken es, statt sich damit zu verbinden.
Das größte Problem ist dabei das der Kompassfindung, denn die vermeintlich verlässlichsten und subjektivsten Gefühle, namentlich die der Lust und Unlust, die auf einer intuitiven Ebene als Orientierung dienen und mir sagen sollen, wie ich zu etwas stehe, sind selbst nicht authentisch und unschuldig, sondern ebenfalls gesellschaftlich durchrastert. Die Fiktion fertiger Gedanken ebenso wie die fertiger Gefühle ist so falsch wie frustrierend, das Fertige himmelweit von dem entfernt, was Lust sein kann.
Das Lustvolle bewegt sich wie der Zweifel immer an den Rändern des Vorgegebenen, einfach deswegen, weil niemand vollständig in den vorgegebenen identitären Rastern und Mustern aufgeht. Der Zweifel signalisiert deswegen keinen Mangel, sondern einen ambivalenten Überschuss, den Überschuss dessen, was an der eigenen Subjektivität über das Vorgegebene hinausweist. Der Zweifel ist das, was mir ermöglicht, mir die Regeln selbst auszusuchen, nach denen ich leben will, das, was mir ermöglicht, öffentliche wie private Räume so zu verändern, dass ich gerne mit Anderen in ihnen lebe. Dadurch wird er politisch. Und dieser Überschuss enthält eine andere Lust als die Gefühls-Readymades. Die Kompassfindung muss sich an diesem Zweifel-Überschuss orientieren.
Der Zweifel ist ein widerständiger Impuls. Seine Widerständigkeit besteht deswegen jedoch nicht einfach in der Negation. Wenn der Common Sense ein monochromes Ja oder Nein ausruft, fungiert der Zweifel als Alarmsignal an der vorgeblichen Uniformität/Einstimmigkeit. Zum einen werden im Zweifel die Widersprüche und Ungereimtheiten des Selbstverständlichen spürbar, in der Widerständigkeit gegen diese vorgebliche Einstimmigkeit liegt seine Verneinungskraft. Der Zweifel wird zum Sensor für das Falsche im scheinbar Richtigen. Spürbar werden zum anderen die Ränder des Common Sense, von denen ein scheinbares Unisono glaubt, dass es dort nicht weiterginge. Dem setzt der Zweifel ein Doch entgegen, bewegt sich also an den Rand und über ihn hinaus. Die Ränder des Common Sense sind die Ränder des Verständlichen, scheinbar Selbstverständlichen. Ihre Erkundung stellt deswegen „Flirts mit der Sinnlosigkeit“ dar, weil an den ausfransenden Rändern des Verständlichen auch die Kriterien für Richtig und Falsch aufhören.
James beschreibt den Zweifel als eine Verwirrung, die durch die Kollision von alt und neu zustande kommt. Auf diese Verwirrung, die entsteht, wenn sicher geglaubte Gewohnheiten verunsichert werden, folgt laut James die Vermählung von „alt“ und „neu“ (James 1994, 40f.). Die Anbahnung, die Vermählungen vorausgeht, ist üblicherweise durch den zugleich unsicheren und lustvollen Zustand der Verliebtheit geprägt. Man könnte sagen, dass dieser Eros zwischen „alt“ und „neu“ den imaginativen Zweifel charakterisiert.
Denn immer, wenn wir uns wirklich fragen, wie wir etwas finden, führt dies zu einer Problematisierung und Spürbarmachung der eigenen Kriterien. Imaginatives Zweifeln ist Kriterien-Entsicherung. Verblüffenderweise empfinden wir diesen Vollzug der Entsicherung als lustvoll. Die Lust liegt in der unvorhersehbaren Mobilisierung der eigenen Maßstäbe auf der Suche nach einem Urteil, einem Standpunkt.
Diese Lust hat mehrere Aspekte: einer davon ist der Aspekt der Befreiung, genauer gesagt einer Ent-Entfremdung. Er hat damit zu tun, dass jene Kriterien, die wir für unsere eigenen halten, und mit deren Hilfe wir uns in der Welt zurechtzufinden hoffen, eigentlich gar nicht unsere eigenen sind. Sie sind es solange nicht, wie sie nicht in unseren jeweiligen Gesichtskreis getreten sind. Und normalerweise tun sie dies nicht, sondern befinden sich außerhalb dessen, hinter unserem Rücken. Wenn aber plötzlich die Kriterien hinter unserem Rücken hervortreten und sich zu erkennen geben, empfinden wir dies als lustvoll, weil sie uns nicht mehr bestimmen, sondern wir mit ihnen spielen können. Im Gewissheitskosmos denken und handeln wir mit Kriterien und empfinden ihre Infragestellung als Bedrohung, in imaginativen Zweifeln werden diese Kriterien selbst spürbar und damit verhandelbar. Wenn wir uns fragen, wie wir etwas finden, ohne mit der Frage gleich fertig sein zu wollen, gerät etwas in uns in Bewegung. Unser Körper reagiert, unsere Fantasie beginnt zu assoziieren, sucht nach greifbaren Ähnlichkeiten oder Unterschieden zu bereits bekannten Mustern, z.B. in anderen Kunstformen. Gleichzeitig mobilisieren wir unsere Sprache und versuchen das, was mit uns gerade passiert, auf einen Begriff zu bringen. Es ist so, als wenn uns etwas auf der Zunge liegt oder wir nach einem passenden Wort für etwas suchen. Zugleich suchen wir nach neuen Formen des Verstehens, und dabei gehen Finden und Erfinden Hand in Hand. Die Rezeption ist darum immer auch ein produktiver poetischer Prozess, und die Produktion kommt nie ohne rezeptive Urteilsbildung aus.
Anders als die meisten Alltagshandlungen oder -überlegungen ist dieser Prozess nicht rein instrumentell oder strategisch. In imaginativen Zweifeln geht es nicht darum, etwas bereits Festgelegtes zu wollen. Denn wenn wir nach einem Kompass suchen, um herauszufinden, wie wir zu etwas stehen, das nicht in unsere üblichen Urteilsschemata passt, wenn wir versuchen zu sondieren, wie es gerechter und schöner sein könnte, dann helfen vermeintlich rationale Argumentationen allein nicht weiter, weil sie sich innerhalb des bestehenden Common Sense bewegen.
Die gewaltfreie Überprüfung der eigenen Kriterien und Maßstäbe führt nicht nur zu einer Neujustierung und Neubildung eigener begrifflicher Kriterien, mithilfe derer man denkt, spricht und handelt – sie führt auch, kantisch gedacht, zu einer Öffnung des eigenen nichtbegrifflichen Wahrnehmungsrahmens. Imaginative Zweifel können uns lehren, Dinge zu sehen oder zu hören, die wir vorher nicht sehen oder hören konnten. Sie führen, mit Rancière gesprochen, zu einer Neuaufteilung des Sinnlichen (Rancière 2008, 69). Die Ent-Entfremdung der Kriterienentsicherung entfaltet sich, wenn die vermeintlich eigene Identität in ihrer Entfremdung erfahrbar und dadurch greifbar wird. Wenn die Anteile, die uns auszumachen scheinen, sich in ihrer Fremdheit auffächern und es uns erlauben, neue Bezüge zu ihnen herzustellen: Das Selbstverständliche muss erst unverständlich werden, um es neu verstehen zu können. Umgekehrt rückt das auf den ersten Blick Fremde und daher Zweifelhafte näher.
Damit hängt ein weiterer Punkt zusammen: Innerhalb unseres Common Sense sind Überzeugungen tendenziell entropisch – wenn wir nichts tun, dann fallen wir trotz vorübergehender Zweifel wieder in alte Überzeugungen und daran geknüpfte Gewohnheiten zurück. Darum, dass die Wohnung wieder unordentlich wird, muss ich mir keine Sorgen machen. Das wird sie von allein, wenn ich nicht handele. Welche Ordnung ich meiner Wohnung gebe, steht dagegen sehr wohl in meinem Ermessen, aber dafür benötige ich Zeit, meinen Zweifeln an der bislang möglicherweise unbefriedigenden Ordnung handelnd nachzugehen. Mit Überzeugungen ist es ähnlich. Gerade in politischer Hinsicht ist das Zweifeln an der bestehenden Ordnung und das daran geknüpfte Neusondieren ein notwendiger aktiver Prozess, um nicht die alte Unordnung problematischer Überzeugungen zu reproduzieren. Deswegen steht im Zentrum des Pragmatismus der Prozess der Festlegung von Überzeugungen, nicht ihr Abschluss. Die Frage ist daher: Wie lange und v.a., auf welche Weise hält man sich im Gebiet des Zweifels auf? Der imaginative Zweifel wird aktiv und je mehr er genossen werden kann, umso länger kann man sich im ungewissen Gebiet aufhalten und Neues erkunden. Darum ist es so wichtig, diesen Zweifel aufzuwerten, um sich darin zu üben, das ungewisse Gebiet, auf dem sich überhaupt erst sinnvolle Neuerungen entwickeln können, nicht vorschnell zu verlassen, nur um wieder auf scheinbar sicheres, tatsächlich aber fragwürdiges Festland zu gelangen.
Der Pragmatismus hat Recht, wenn er die Annahme kritisiert, man könne willentlich und dauerhaft an allem zweifeln. Zweifel sind spezifisch und situativ, das gilt auch für imaginative Zweifel: Sie lassen sich nur deswegen genießen, weil sie nicht alles auf einmal neu sondieren. Der Skeptizismus ist so fiktiv wie die Position der Gewissheit und ebenso selbstwidersprüchlich, weil beide absolutistisch konzipiert sind. Rortys Charakterisierung der liberalen Ironikerin als Figur, die „radikale und unaufhörliche Zweifel“ an ihrer eigenen Position hegt, fällt in diese absolutistische Position zurück, die den Grundsätzen des Pragmatismus widerspricht, übertrieben und unrealistisch ist (Rorty 1989, 127). In gewisser Weise stellt sie eine Karikatur des Minus-Subjekts dar.
Niemand hält sich dauerhaft in Selbstzweifeln auf – es sei denn, er wird von anderen dazu gezwungen, dadurch, dass er in eine Position gebracht wird, die strukturell demütigend ist. Das ist dann jedoch kein imaginativer zwangloser Zweifel, sondern strukturelle Gewalt.
Gewissheitswille
Identität hingegen bildet sich durch und innerhalb von Strukturen. Das Phantasma selbstverständlichen Gewissheitswillens macht sich privilegienblind und nimmt die Ausschlüsse dieser Strukturen billigend in Kauf. Positionen zweifelsfreier Selbstgewissheit operieren immer auf Kosten anderer und sind genau genommen gar keine wirklich eigenständig erlangten Positionen. Sie beten lediglich im Modus automatischer Reproduktion nach, womit sie von früh auf imprägniert worden sind: Je privilegienreicher, desto blinder. Um jedoch eine Position zu beziehen, zu der man wirklich stehen kann, muss man sich durch Zweifel ent-imprägnieren, ent-identifizieren.
Ein in diesem Zusammenhang verbreitetes Missverständnis ist, dass Zweifeln eine möglicherweise anspruchsvolle, deshalb aber um nichts weniger destruktive Form der Selbstkasteiung darstellt, die eigentlich Zeitverschwendung ist. Zweifel werden mit Desorientiertheit, Verzweiflung, Depression und anderen Unlustzuständen in einen Topf geworfen. Dieses Missverständnis hat mehrere Ursachen, die Hauptursache aber ist das Festhalten an der ebenso verheerenden wie ermüdenden binären Denklogik, die sich eigentlich schon längst überlebt haben sollte: Ja/nein, schwarz/weiß, richtig/falsch, Männer/Frauen, Natur/Kultur, usw. usw. Innerhalb dieser Logik versteht man Zweifel als quälenden Wartezustand an der Weggabelung der nächsten Entscheidung, entlang des Musters: Soll ich meinen Mann verlassen oder nicht? Soll ich in die Schlägerei eingreifen oder nicht? Zweifel wären dann nichts anderes als eine lästige Unterbrechung und Vorbereitung auf die nächste Eindeutigkeit, auf die nächste Gewissheit; ein vermeintlich vermeidbarer Luxusgedanke, der im Selbstoptimierungskatalog als erstes gestrichen wird. (Gut, dass ich nicht in die Schlägerei eingegriffen habe – viel zu gefährlich. Das war das.)
Es braucht eine Ästhetik des Zweifels, um sich klarzumachen, dass Zweifel nur dann als lästige Störung aufgefasst werden, wenn von einer Grundhaltung fertiger Selbstbehauptung ausgegangen wird. Die Freiheit der Subjektivität, die mit ästhetischen Zweifeln einhergeht, ist jedoch geradewegs das Gegenteil davon. Sie funktioniert nur in der vorübergehenden Suspension des Eigeninteresses. Denn, in den Worten von Levinas, die „Freiheit schadet ihrem Ruf bei dieser Ausgewogenheit der Rechnungen in einer Ordnung, in der die Verantwortungen genau den Freiheiten entsprechen, die man sich genommen hat, in der diese Freiheiten die Verantwortungen aufwiegen. [...] Die Freiheit im wahrhaften Sinne kann nur ein Einspruch sein gegen solche Buchführung, Einspruch durch eine Unentgeltlichkeit“ (Levinas 1992, 279). Und es ist gerade dieses Aufgeben des Selbstinteresses, dieser Einspruch durch eine Unentgeltlichkeit, welche einen Zweifel ermöglichen, der nicht nur die kritische Reflektion auf bestehende Rationalitätskriterien, sondern auch überhaupt erst lebendige Lust ermöglicht. „Nicht in ihrer Freiheit erweist sich daher die Subjektivität als absolute, ist doch die Freiheit in einem aufgeblasenen und verdorbenen, verratenen oder verrückten Willen unmöglich“ (ebd. 141). Es muss stattdessen also um die Freiheit einer Subjektivität gehen, die sich von den Tauschverhältnissen der Selbstbehauptung zu lösen vermag. Denn sie ist nicht nur weniger gefährlich, sondern auch weniger langweilig.
Literatur:
Arendt, Hannah: Vita Activa oder vom tätigen Leben, München 1958.
Atwood, Margaret: Payback. Schulden und die Schattenseite des Wohlstands, München: Pieper 2008.
Theodor W. Adorno, Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt/M.: Fischer 1990.
Bedorf, Thomas: Verkennende Anerkennung. Über Identität und Politik, Berlin: Suhrkamp 2010.
Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt a. M: Suhrkamp 1994.
Charim, Isolde: Ich und die Anderen. Wie die neue Pluralisierung uns alle verändert, Wien: Paul Zsolnay 2018.
Dewey, John: Die Suche nach Gewissheit. Eine Untersuchung des Verhältnisses von Erkenntnis und Handlung, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1998.
Frye, Marilyn: Politics of Reality, New York: Crossing Press 1983.
Levinas, Emmanuel: Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht, Freiburg: Alber 1992.
Rancière, Jacques: Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien, hg. von Maria Muhle, Berlin: b_books Verlag 2008.
Rorty, Richard: Kontingenz, Ironie, Solidarität, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1989.
Rorty, Richard: „Feminismus und Pragmatismus“, in: Wahrheit und Fortschritt, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2000, 291-329.
Salaverría, Heidi: "Ästhetische Zweifel? Zu einem rebellischen Antiheroismus", Vortragsmanuskript, Jahreskongress der "Deutschen Gesellschaft für Ästhetik" in Offenbach 2018.
Salaverría, Heidi: Spielräume des Selbst. Pragmatismus und kreatives Handeln, Berlin: Akademie-Verlag 2007.
Salaverría, Heidi: „Prophetische Zweifel und der ‚dunkel erahnte Zusammenhang von Kunst und Folter’ – zur politischen Ästhetik Rortys’“, in: Müller, Martin (Hrsg.): Handbuch Richard Rorty. Wiesbaden: Springer (im Erscheinen).
Salaverría, Heidi: “The Beauty of Doubting. Political Reflections on a Rebellious Feeling,” in: Solveig Øvstebø und Karsten Lund (Hrsg.): Between the Ticks of the Watch. Chicago: The Renaissance Society at the University of Chicago (2017), 153-183.
She She Pop, Testament – Verspätete Vorbereitungen für den Generationswechsel nach Lear UA 2010, HAU ZWEI, Hebbel am Ufer Berlin.
Smith, Zadie, Interview: On Shame, Rage, and Writing, with Synne Rifbjerg in August 2017. Louisiana Channel, Louisiana Museum of Modern Art, 2018. https://www.youtube.com/watch?v=4LREBOwjrrw.
Teile dieses Essays erscheinen in: Salaverría, Heidi: Zweifel. Kleiner Stimmungsatlas, Hamburg: Textem Verlag (im Erscheinen), sowie in: Salaverría, Heidi: „Prophetische Zweifel und der ‚dunkel erahnte Zusammenhang von Kunst und Folter’ – zur politischen Ästhetik Rortys,“ in: Müller, Martin, Hrsg. Handbuch Richard Rorty. Wiesbaden: Springer (im Erscheinen).
[1] Levinas spricht in diesem Zitat vom Sein (im frz. essence), siehe dazu auch die Erläuterungen des Übersetzers Thomas Wiemer, 17, Fn. a.
[2] Die afroamerikanische Musik beispielsweise verwandelt in sehr unterschiedlichen Formen die traumatische Geschichte der Sklaverei und des Rassismus. Im Spielen wie im Hören von Jazz etwa wird durch die Form der Improvisation, die harmonische Öffnung und v.a. auch durch die rhythmische Struktur ein Schwebezustand erzeugt, der eine sehr lustvolle Form der Suspension des eigenen Standpunktes darstellt. Siehe dazu Salaverría, Heidi: „Synkopischer Widerstand – Rhythmen postkolonialen Denkens“.